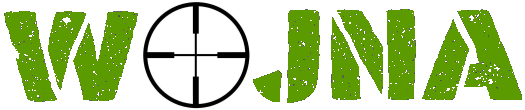Union und SPD haben sich nach mehr als achtstündigen Verhandlungen im Kanzleramt auf zentrale Reformen geeinigt. Die Koalitionsspitzen erzielten Kompromisse beim Bürgergeld, der Rente und der Verkehrspolitik. Einige Streitpunkte bleiben jedoch ungelöst.
Das Bürgergeld wird grundlegend umgestaltet und zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende. Rund 5,5 Millionen Bezieher müssen sich auf verschärfte Bedingungen einstellen. Die Änderungen zielen auf strengere Kontrolle und höhere Mitwirkungspflichten ab.
Strengere Regeln für Grundsicherung
Bei versäumten Terminen im Jobcenter drohen künftig drastische Konsequenzen. Wer einen ersten Termin verpasst, erhält sofort eine zweite Einladung. Nach dem Versäumen des zweiten Termins werden die monatlichen Zahlungen um 30 Prozent gekürzt.
Bei einem dritten versäumten Termin stoppen die Geldleistungen komplett. Bleibt der Bezieher auch im Folgemonat fern, verliert er sämtliche Unterstützung einschließlich der Wohnkosten. Härtefälle sollen berücksichtigt werden: «wenn mögliche gesundheitliche oder andere schwerwiegende Gründe für das Nichterscheinen festgestellt werden».
Das Schonvermögen wird ebenfalls reduziert und künftig an die Lebensleistung geknüpft. Damit können Bezieher weniger Ersparnisse behalten, bevor sie Anspruch auf Grundsicherung haben.
Aktivrente startet 2026
Die neue Aktivrente ermöglicht Rentnern ab dem ersten Januar 2026 einen steuerfreien Zuverdienst von 2.000 Euro monatlich. Das entsprechende Gesetz soll schnellstmöglich verabschiedet werden und notfalls rückwirkend in Kraft treten.
Die Regelung gilt ab Erreichen der Regelaltersgrenze bei regulären, sozialversicherungspflichtigen Jobs. Der Steuervorteil wird bereits beim Lohnsteuerabzug gewährt, nicht erst nach der Steuererklärung. Ein Progressionsvorbehalt existiert nicht.
Milliarden für E-Auto-Förderung
Ein neues Förderprogramm für Elektroautos soll besonders Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimaneutrale Mobilität unterstützen. Bis 2029 stehen dafür Milliardenbeträge bereit.
Die Finanzierung erfolgt über den EU-Klimasozialfonds plus drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das Programm zielt auf emissionsfreie Fahrzeuge und den Übergang zu nachhaltiger Mobilität ab.
Verkehrsprojekte werden fortgesetzt
Nach wochenlangen Diskussionen stellten die Koalitionsspitzen klar: Das Verkehrsnetz wird nicht nur saniert, sondern auch «durch Neu- und Ausbau» erweitert. «Deshalb sagen wir: Alles, was baureif ist, wird auch gebaut», heißt es im Beschlusspapier.
Drei Milliarden Euro werden im schuldenfinanzierten Infrastruktur-Sondervermögen für den Zeitraum 2026 bis 2029 umgeschichtet. Nach zwei Jahren erfolgt eine Überprüfung, ob die Mittel ausreichen.
Verbrenner-Aus bleibt umstritten
Beim EU-weiten Aus für Verbrennermotoren ab 2035 fanden Union und SPD trotz nächtlicher Verhandlungen keine gemeinsame Position. Man habe noch «nicht zu einer abschließenden Bewertung gefunden», sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU).
SPD-Chef Lars Klingbeil kündigte jedoch eine zügige Positionierung der Bundesregierung zum Automobilthema an. Beide Seiten wollten dem Autogipfel am Nachmittag nicht vorgreifen.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz überarbeitet.