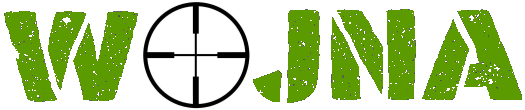Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen, sieht die Sicherheitslage in Deutschland deutlich verschärft. Spionage und Sabotage zählen zu den größten aktuellen Bedrohungen für den Inlandsgeheimdienst.
«Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen zehn Jahren in der Tat verschoben und verschärft», sagte Selen der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde müsse künftig stärker nach dem Grundsatz verfahren: «Prävention, Detektion und Disruption.»
Zu den Schwerpunkten gehören laut Selen multipolare Bedrohungen, Cyberangriffe, internationaler Terrorismus und gewaltbereiter Extremismus. Entscheidend sei die frühzeitige Erkennung von Netzwerken und die Identifizierung der Akteure im Hintergrund.
75 Jahre Verfassungsschutz
Das Bundesamt für Verfassungsschutz feiert an diesem Montag sein 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Bundesinnenministerium. Die Behörde wurde am 7. November 1950 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges gegründet.
Die westalliierten Besatzungsmächte genehmigten der jungen Bundesrepublik damals den Aufbau eines Nachrichtendienstes zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Mit Blick auf die Nazi-Zeit untersagten sie dem Inlandsgeheimdienst jedoch ausdrücklich jede Form von Polizeibefugnissen.
Das sogenannte Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten gilt bis heute. Dennoch werden Informationen zu konkreten Sachverhalten ausgetauscht - etwa im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin.
Wandel in der Öffentlichkeitsarbeit
Früher warb der Verfassungsschutz mit dem Slogan «Im Verborgenen Gutes tun!» um neue Mitarbeiter. Seit 2021 lautet die Botschaft an potenzielle Bewerber: «Im Auftrag der Demokratie».
Selen beschreibt die doppelte Stoßrichtung seiner Behörde: «Als Abwehrdienst verteidigen wir die Sicherheitsinteressen des deutschen Staates vor inneren und äußeren Gefahren und dienen zugleich den Schutz- und Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger.»
Die Analysen des Bundesamtes bilden häufig die Grundlage für Vereinsverbote oder Festnahmen von Extremisten. «Festnahmen und oftmals dann auch sich anschließende Verurteilungen von Extremisten und Terroristen wären in vielen Fällen ohne den Verfassungsschutz nicht möglich», betont Selen.
Dunkle Kapitel und aktuelle Konflikte
Zu den unrühmlichen Momenten der Behördengeschichte zählt die Schredder-Affäre nach dem Auffliegen des NSU. BfV-Präsident Heinz Fromm trat im Juli 2012 zurück, nachdem bekannt wurde, dass Verfassungsschützer Akten zur rechten Szene vernichtet hatten.
Der Nationalsozialistische Untergrund hatte aus rassistischen Motiven neun Menschen mit Migrationshintergrund und eine Polizistin ermordet. Die Affäre belastete das Ansehen der Behörde schwer.
Von den Bundestagsparteien hat aktuell die AfD die größten Probleme mit dem Verfassungsschutz. Das BfV hatte die Partei Anfang Mai zur «gesichert rechtsextremistischen Bestrebung» hochgestuft, die Einstufung nach einer Klage aber wieder auf Eis gelegt.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.