Jubiläumsfeier zum 75. Tag der Heimat
Am 05.08.1950 wurde die Charta der deutschen Heimatvertriebenen unterzeichnet und am Tag danach vorgestellt. Über dieses „Gründungsdokument“ der Bundesrepublik sprach Florian Lippold mit Marc Halatsch, dem Generalsekretär des Bundes des deutschen Vertriebenen.
Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Aber was genau ist die Charta eigentlich?
Die Charta ist sozusagen das Grundgesetz der Vertriebenen und ihrer Verbände. Mit ihr haben die damals wichtigsten Vertreter der Verbände selbst in einer sehr schwierigen Zeit gemeinsam grundlegende Positionen festgeschrieben. Dazu gehörten: Verzicht auf Rache und Vergeltung, die Arbeit an einem geeinten und friedlichen Europa und die Mitwirkung am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Gleichzeitig haben sie mit dem „Recht auf Heimat“ das Fundament dafür gelegt, dass das Problem politisch motivierter Vertreibungen als ein Weltproblem erkannt und auch behandelt wurde.
 Marc Halatsch, Generalsekretär des BdV,
Marc Halatsch, Generalsekretär des BdV,Foto: BdV/Bildkraftwerk
Können Sie die Situation der Vertriebenen und die Notwendigkeit der Charta etwas näher erläutern?
Es waren ja nach dem 2. Weltkrieg mehr als 15 Millionen Deutsche geflüchtet oder vertrieben worden, und von denen alleine kamen knapp 8–9 Millionen in Westdeutschland an. Dort standen sie buchstäblich vor dem Nichts. Sie hatten kein Dach über dem Kopf, keine Arbeit und zerrissene Familien. Knapp die Hälfte lebte auch noch in Lagern oder Notunterkünften, oft in bitterster Armut. Dazu kam noch das Gefühl, entwurzelt zu sein: Die Heimat war fern, das soziale Gefüge weg und die eigene Identität schwer verletzt. Mit heutigem Vokabular würde man wohl sagen: Die Vertriebenen waren eine vulnerable Gruppe.
Die Vertreter der verschiedenen Herkunftsgebiete haben diese Probleme klar erkannt und gesagt: „Wenn wir jetzt kein Zeichen nach innen und außen setzen, kann die ganze Situation eskalieren.“ Es ging also darum, die Unzufriedenheit in eine gute Richtung und auf Ziele zu lenken, auf die man gemeinsam hinarbeiten konnte. Und das bedeutete in erster Linie: selbst mitwirken, anpacken, aufbauen. Körperlich, aber auch intellektuell durch eine aktive politische Beteiligung. Und diese Beteiligung sollte über Deutschland und Europa hinausgehen, denn die Heimat der Vertriebenen lag außerhalb neuer und alter Grenzen.
Nach innen hatte die Charta dann auch eine immense Wirkung, die so stark war, dass der ehemalige deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) die Charta auch im Amt mehrfach als ein Gründungsdokument der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet hat. Nach außen aber, besonders im Einflussbereich Stalins, wurde die Charta oftmals kleingeredet.
Zusammengefasst legte die Charta den Grundstein für die Arbeit der Vertriebenenverbände. Seit der Unterzeichnung der Charta am 5. August 1950 und ihrer Verkündung am 6. August 1950 feiern wir jedes Jahr den Tag der Heimat. Und deswegen kommen wir auch dieses Jahr in Stuttgart, wo die Charta zuerst vorgestellt wurde, wieder zusammen.
 Der Tag der Heimat fand im Neuen Schloss in Stuttgart statt.
Der Tag der Heimat fand im Neuen Schloss in Stuttgart statt.Foto: VdG
Die Charta wurde damals von einem „einfachen Vertriebenen“ anonym vorgetragen, erst später hat sich herausgestellt, dass der Verkünder Manuel Jordan, ein Vertriebener aus Oberschlesien, war. Warum sollte die Verkündung der Charta anonymisiert geschehen?
Man muss bedenken, dass unter den Organisationen und sicher auch unter den Vertretern dieser durchaus Konkurrenz herrschte. Und die Lösung der Konkurrenz war, dass man die Charta durch einen einfachen Vertriebenen vorstellen ließ. Es sollte kein West- oder Ostpreuße sein, kein Ober- oder Niederschlesier und auch kein Sudetendeutscher, der die Charta vorstellen sollte, sondern ein einfacher deutscher Heimatvertriebener. Rückblickend war das für die Ziele der Charta ein Glücksfall, weil sie dadurch eben nicht regional eingeordnet werden konnte. Sie war damit ein Dokument für alle deutschen Heimatvertriebenen.
 Am Vertriebenendenkmal in Bad Canstatt wurden Kränze niedergelegt.
Am Vertriebenendenkmal in Bad Canstatt wurden Kränze niedergelegt.Foto: VdG
Zwei der Hauptziele der Charta sind ja der Wiederaufbau Deutschlands und der Einsatz für ein geeintes Europa. Welche Bedeutung hat die Charta heute noch, in Zeiten eines wiedervereinten Deutschlands und der EU?
Das stimmt, und trotzdem bleibt die Charta ein Grundlagendokument und das „Grundgesetz“ der Heimatverbände und ihrer Mitglieder. Auch wenn viele der damals neuen Impulse wie grenzüberschreitende Verständigung und das „Recht auf Heimat“ heute als selbstverständlich betrachtet werden. Was noch offen ist – und daran halten wir auch fest – ist ein weltweites Verbot von politisch motivierten Vertreibungen. Die Charta ist in Teilen ein Produkt ihrer Zeit, aber auch ein zeitloses Dokument und kann somit ein Vorbild für andere sein.
Die Charta ist noch immer ein Grundlagendokument und somit das „Grundgesetz“ für alle Heimatverbände.
Hat die Charta damit eher an Bedeutung gewonnen oder verloren?
Da hilft es, wenn man sich mehrere Beispiele vor Augen führt. Der europäische Einigungsprozess ist zum Beispiel nach dem Fall des Eisernen Vorhangs weit vorangeschritten. Doch spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sehen wir wieder, wie wichtig das Ziel eines friedlichen und geeinten Europas ist und bleibt. Ein anderes Beispiel: Die Vertriebenen haben ihren Anteil am Wiederaufbau Deutschlands und ihren Beitrag zum Erfolg des Landes erbracht. Zugleich waren die Vertriebenen sehr heterogene Gruppen aus verschiedenen Provinzen, auch wenn sie als Deutsche nach Deutschland kamen. Sie mussten sich daher an einem neuen Ort eine neue Lebensgrundlage schaffen. Wie Vertriebene sich daher gemeinsam organisieren und etwas aufbauen können, auch dafür ist die Charta noch immer gut. Das dritte Beispiel ist Rache und Vergeltung: Es ist eigentlich klar, dass mit Rache und Vergeltung keine Politik gelingen kann. Das Ziel in Annäherungs- und Aufarbeitungsprozessen muss daher immer eine gemeinsame Verständigung sein. Ebenso die Anerkennung von vergangenen Verbrechen und ein entsprechender Ausgleich. Das ist die Grundlage grenzübergreifender Zusammenarbeit überhaupt.
 Auch Vertreter des VdG legten Kränze in Gedenken an die Vertriebenen nieder.
Auch Vertreter des VdG legten Kränze in Gedenken an die Vertriebenen nieder.Foto: VdG
Wurde die Charta in den letzten 75 Jahren angepasst oder verändert?
Es wurde schon häufig über das Dokument nachgedacht. Vor 5 Jahren, also zum 70. Jahrestag der Charta, wurde vom BdV eine Deklaration verabschiedet mit wichtigen Punkten, so wie der Vertreibung als Weltproblem oder dem „Recht auf Heimat“ in der heutigen Zeit. Man war sich aber in allen Beratungen, und das gilt auch für die Zeit davor, einig, dass das historische Dokument nicht verändert werden soll. Zwar sind einige Formulierungen nach 75 Jahren europäischer Geschichte nicht mehr zeitgemäß, dessen sind sich die Mitglieder des Präsidiums auch bewusst. Aber die Inhalte der Charta bestehen ohne Abstriche so noch immer.
 Auch Mitglieder der deutschen Minderheiten aus Europa nahmen an den Festlichkeiten teil.
Auch Mitglieder der deutschen Minderheiten aus Europa nahmen an den Festlichkeiten teil.Foto: VdG
Kommen wir damit nochmal zur Veranstaltung selbst, also dem Festakt zum „75. Tag der Heimat“. Welche Mitglieder aus Politik und Nichtregierungsorganisationen werden erwartet?
Ich möchte zuerst einmal mit Friedrich Merz, also dem deutschen Bundeskanzler, anfangen, einfach weil wir uns sehr darüber freuen, dass er an diesem besonderen Jubiläum teilnehmen wird. Ebenso freuen wir uns sehr, dass das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Minister Peter Hauk und den Staatssekretär Thomas Blenke, an dem Festakt teilnehmen wird. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper wird sowohl am Festakt als auch an der Kranzniederlegung am Vertriebenendenkmal teilnehmen. Ebenso ist ein Grußwort vom Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten in der FUEN, Herrn Bernard Gaida, geplant. Und das ist insbesondere nochmal wichtig, weil die Situation der Heimatverbliebenen ja nochmal eine ganz andere ist als die der Heimatvertriebenen. Dass diese Erfahrungen bei der Veranstaltung nochmal anklingen werden, halten wir für besonders wichtig. Ebenso wird es einen wissenschaftlichen Impuls des Tübinger Historikers Mathias Beer geben. Und der Präsident des BdV, Herr Dr. Bernd Fabritius, wird natürlich auch ein paar Worte sprechen. Weiterhin werden viele verschiedene Abgeordnete aus Bundes- und den Landtagen erwartet sowie die Mitglieder diverser Landes- und Heimatverbände, so auch des VdG.
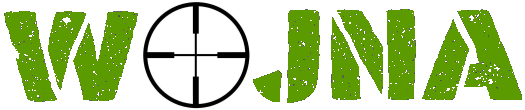













![Trener umiejętności mentalnych - kim jest i czym się zajmuje? [WIDEO]](https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/sport/2025/mwich.jpg)