Erinnerung an den 1. September 1939
Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Auf Einladung des Deutschen Polen-Instituts, der Stabsstelle „Deutsch-Polnisches Haus“, des Auswärtigen Amts und der Botschaft der Republik Polen in Deutschland erinnerten zahlreiche Gäste aus Deutschland und Polen – darunter Politikerinnen und Politiker, Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen sowie der Zivilgesellschaft – an die tragischen Ereignisse und die Millionen Opfer.
Im Juni wurde mitten im politischen Herzen Berlins der „Gedenkort für Polen 1939 bis 1945“ in der Heinrich-von-Gagern-Straße eröffnet. Der Standort – in unmittelbarer Nachbarschaft des Bundeskanzleramts und des Bundestages – war bewusst gewählt. An dieser Stelle stand einst die Kroll-Oper.
 Stasstaminister Wolfram Weimer (Mitte)
Stasstaminister Wolfram Weimer (Mitte)Foto: Andrea Polanski
In ihr tagte seit dem Brand des gegenüberliegenden Reichstagsgebäudes das sogenannte Scheinparlament der Nationalsozialisten. Hier verkündete Adolf Hitler am 1. September 1939 den deutschen Überfall auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann.
Gedenkveranstaltung und Reden
Die Gedenkveranstaltung begann mit Ansprachen von Dr. Géza Andreas von Geyr, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jan Tombiński, geschäftsträger a.i. der Republik Polen in Deutschland, sowie Dr. Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien.
 Foto: Andrea Polanski
Foto: Andrea Polanski„Die deutsche Verantwortung für diese Verbrechen bleibt, sie verjährt nicht. (…) Die deutsche Verantwortung besteht fort, auch die Verantwortung, Sorge dafür zu tragen, dass sich niemals wiederholt, was dort geschah. Sie geht an alle Generationen Deutscher über, die noch kommen werden“, sagte Staatsminister Weimer.
Im Anschluss legten die Versammelten Kranz- und Blumengebinde nieder.
Bedeutung für das Deutsche Polen-Institut und die deutschen Minderheiten
„Es ist wichtig, an einem so bedeutenden Datum wie dem 1. September, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, gemeinsam innezuhalten. Polen und die polnische Gesellschaft leiden bis heute an den Folgen dieses Verbrechens,” erklärt Peter Oliver Loew, Direktor des Deutschen Polen-Instituts. „Umso wichtiger sind solche Momente, die auch wenn sie nicht fröhlich sein können, doch Mut machen, sich weiterhin intensiv mit unseren deutsch-polnischen Beziehungen auseinanderzusetzen.“
„Die deutsche Verantwortung für diese Verbrechen bleibt, sie verjährt nicht. (…) Sie geht an alle Generationen Deutscher über, die noch kommen werden.“
Bernard Gaida, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der FUEN, legte als Vertreter aller Deutschen Minderheiten Blumen nieder:
„Als Sprecher aller deutschen Minderheiten in Europa und Zentralasien ist mir dieses Gedenken besonders wichtig. Gerade angesichts des Angriffs auf die Ukraine und des Krieges in Europa wird deutlich, wie bedeutsam es ist, an die Grausamkeiten der Vergangenheit zu erinnern. Gedenken ist wie ein Schild – es bewahrt die Erinnerung und richtet den Blick in die Zukunft. ‚Nie wieder Krieg‘ klingt hier besonders authentisch.“
 Foto: Andrea Polanski
Foto: Andrea PolanskiKaroline Gil, Leiterin des Bereichs „Integration und Medien“ am ifa, ergänzte:
„Wir sind gerade mit unseren IFA-Entsandten, Kulturmanagerinnen und Redakteurinnen in Berlin zu unserem Einführungsseminar zusammengekommen. Dieses fällt immer auf den 1. September – ein sehr wichtiger Tag für ganz Europa, besonders aber für Polen. Wir gedenken des deutschen Angriffs auf Polen 1939. Dieser Tag ist für uns von großer Bedeutung, nicht nur für die Entsandten, sondern für alle, denn von dort aus begann das Unheil. Es ist wichtig, dies symbolisch zu zeigen und zugleich zu reflektieren, welche Bedeutung dieser Tag für Projekte der Erinnerungskultur und für die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten hat.“
Kontroverse in Medien
Auf rechten Medienportalen in Polen verbreiteten sich schnell Berichte über einen angeblichen „Skandal“, ausgerufen von TV Republika – es wurde suggeriert, die deutsche Regierung habe „das Gedenken an die polnischen Opfer in kurzen Hosen geehrt“ oder die Blumenkränze auf unangemessene Weise niedergelegt.
 Rolf Nikel Foto: Andrea Polanski
Rolf Nikel Foto: Andrea PolanskiTatsächlich zeigen die Bilder, die die Kontroverse auslösten, einen Mann in Bermudashorts, der einen Kranz rein technisch aufstellt, mehrere Stunden vor Beginn der offiziellen Zeremonie, während Bühne, Podeste und Ständer für die Kränze vorbereitet wurden. Die offizielle Kranzniederlegung erfolgte zu der vorgesehenen Zeit (16:00 Uhr) nach diplomatischem Zeremoniell, mit Teilnahme des polnischen Botschafters, deutscher Regierungsvertreter und weiterer offizieller Gäste.
 Karoline Gil mit Knut Abraham
Karoline Gil mit Knut AbrahamFoto: Andrea Polanski
Die Teilnehmer der Veranstaltung ehrten die polnischen Opfer von Krieg und Besatzung und betonten die volle Verantwortung Deutschlands für diese Tragödien. Die falschen Berichte, die bereits vor Beginn der Zeremonie verbreitet wurden, wurden aus dem Kontext gerissen und führten die Öffentlichkeit in die Irre, wodurch die polnisch-deutschen Beziehungen belastet wurden.
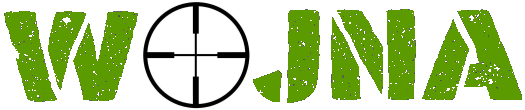


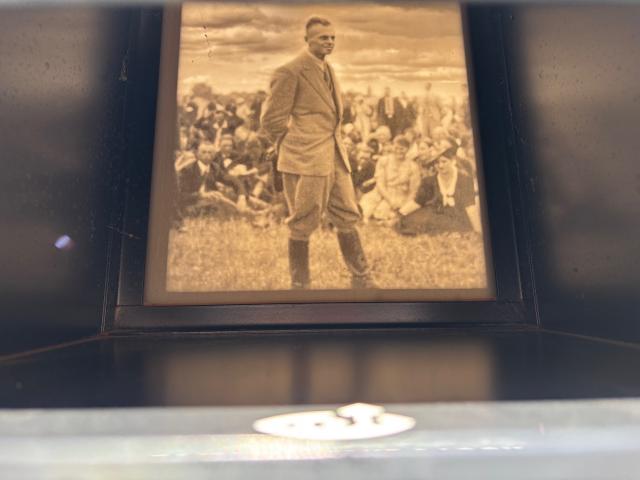


!["Jałta XXI w.". Dyktatorzy znów przechytrzyli Zachód. Xi Jinping i spółka dostali to, czego chcieli [OPINIA]](https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/_R9k9kpTURBXy80Mzg0MzAzMTViMjU4MTIyMjA1Y2E5N2UxZjZiNDI3OC5qcGeTlQMAzF_NC_bNBrqTCaYxNDUyNDcGkwXNBLDNAnbeAAGhMAE/xi-jinping-w-pekinie-3-wrzesnia-2025-r.jpg)

![Wejście na cmentarz nie będzie już przypominało toru przeszkód. Ruszył remont [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/09/cmentarz-parafialny-al.-Brzozowa-remont-nawierzchni-2025.09.04-5.jpg)





