Sisyphus und der Mährische Ausgleich
Während ich diese Zeilen schreibe, sind seit dem Ende meiner dritten und letzten Amtszeit als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) im Rahmen der FUEN zehn Tage vergangen. Einige Wochen zuvor endete auch meine Amtszeit als Mitglied des Präsidiums der FUEN, der größten Vertretung nationaler, ethnischer und sprachlicher Minderheiten in Europa.
Noch ist keine Ruhe eingekehrt, da kommen mir schon Reflexionen. Einige davon stehen im Einklang mit den Verpflichtungen, die noch aus meiner aktiven Zeit übrig geblieben sind. Zum Beispiel die Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Das Angebot, einen Vortrag im Rahmen einer Konferenz an der Tomáš-Masaryk-Universität in Brünn zu halten, lehnte ich zunächst ab, da sie dem 120. Jahrestag des Mährischen Ausgleichs gewidmet war. Es ist vielleicht peinlich, aber ich hatte keine Ahnung, was dieser „Ausgleich“ war. Ich hatte noch nie davon gehört.
Plötzlich hörte ich jedoch innerhalb einer Woche zwei Mal davon. Zuerst in Wien, als der Europaabgeordnete und direkte Nachfahre des letzten Kaisers von Österreich, Karl von Habsburg, im Zusammenhang mit Überlegungen zum künftigen Frieden für die Ukraine darüber sprach. Dann bei der Eröffnung des FUEN-Kongresses in der Südtiroler Hauptstadt Bozen. Einer der Redner bezeichnete den Mährischen Ausgleich als ersten Versuch, eine Minderheitenpolitik auf dem europäischen Kontinent zu schaffen. Das veranlasste mich, die Einladung anzunehmen, denn mir wurde klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Stand der Minderheitenpolitik in Europa und ihren Anfängen in Mähren gibt.
Privat dachte ich mir, dass wir alle, die wir in unseren Ländern oder in den Strukturen der EU mit Ablehnung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schutz von Minderheiten zu kämpfen haben, den „Mythos des Sisyphus” aus eigener Erfahrung kennen.
Worum ging es in diesem Ausgleich von 1905? Um die Chancengleichheit zweier Bevölkerungsgruppen – der deutschen und der slawischen. Geplant war ein System des Zugangs zu Schulen mit tschechischer und deutscher Unterrichtssprache sowie Paritäten bei Kommunalwahlen und in Beamtenpositionen. Der Krieg von 1914 unterbrach die Einführung dieses Systems in der Bukowina und einen ähnlichen Versuch in Galizien. Ich nahm die Einladung an und begann meinen Vortrag mit einem Verweis auf das 1922 geteilte Oberschlesien, wo unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes der sogenannte „kleine Versailler Vertrag“ galt. Damals entstanden auf beiden Seiten der Grenze Schulen: auf der polnischen Seite etwa hundert Schulen, in denen Deutsch unterrichtet wurde – und umgekehrt.
Ich wies darauf hin, dass es im Jahr 2025 trotz der Existenz und Anerkennung der deutschen Minderheit und trotz der Ratifizierung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen keine einzige solche Schule gibt. Das heißt, dass Oberschlesien – heute fast vollständig zu Polen und zur EU gehörig – nach hundert Jahren dieses Stadium noch nicht erreicht hat! Ich verwies kritisch auf die Unterschiede in der Situation der Minderheiten in den einzelnen EU-Ländern und auf das völlige Fehlen einer EU-Politik gegenüber nationalen Minderheiten. Die Europäische Kommission hat ihre Abneigung gegen dieses Thema gezeigt, indem sie die Forderungen der Bürgerinitiative Minority SafePack bekämpfte und die Beschwerde des VdG gegen die polnische Regierung, die Schüler aus deutschen Familien diskriminierte, indem sie ihnen den gleichberechtigten Zugang zum Erlernen der Minderheitensprache verwehrte, nicht angenommen hat.
Dieses traurige Bild habe ich mit folgenden Worten zusammengefasst: „Während der Rede von Karl von Habsburg in Wien kam mir ein Gedanke, als er die Frage stellte, ob der Mährische Ausgleich nicht zu spät vereinbart worden sei. Hätte eine Ausweitung dieses Modells auf die damalige Doppelmonarchie und ganz Europa die tragischen Kriege des 20. Jahrhunderts verhindern können? Diese Frage sollten sich alle vor Augen halten, die Verantwortung für Europa tragen.“
Und privat dachte ich mir, dass wir alle, die wir in unseren Ländern oder in den Strukturen der EU mit Ablehnung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schutz von Minderheiten zu kämpfen haben, den „Mythos des Sisyphus“ aus eigener Erfahrung kennen. Und doch glauben wir, dass der Schutz der Vielfalt der Kulturen, Sprachen und unterschiedlichen Herangehensweisen kleinerer Gemeinschaften an die Geschichte ein sicherer Weg zum Frieden ist als die Stärkung der Dominanz der größeren. Dieser Glaube hat mich insbesondere in den letzten 20 Jahren angetrieben. Mögen wir diesen schwierigen Glauben – trotz des Gefühls, eine Sisyphusarbeit zu leisten – nicht verlieren.
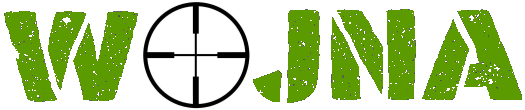






![Uroczysta część sesji. Starosta nagrodził za sport i kulturę [WIDEO, ZDJĘCIA]](https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/zdjecia/2025/img_4057.jpg)










