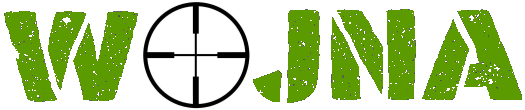Ein Libanese beantragte 2023 in Peine die deutsche Staatsbürgerschaft und musste 23 Fragen beantworten - von der Motivation über Demokratieverständnis bis hin zu Moscheenbesuchen. Die Behörde lehnte ab, da er «nicht einmal über rudimentäre Grundkenntnisse» der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verfüge.
Das Verwaltungsgericht Braunschweig gab dem klagenden Antragsteller recht. Die Behörde habe keine Rechtsgrundlage für die «anlasslos vorgenommene Befragung» gehabt und den Mann «in die Zange genommen». Der Landkreis muss nun ohne Befragung neu entscheiden.
Rekordansturm auf deutschen Pass
Die Entscheidung schlägt hohe Wellen, denn sie berührt grundsätzliche Fragen zur Einbürgerungspraxis. 200.095 Menschen wurden 2023 eingebürgert, 2024 waren es bereits 292.020 - ein deutlicher Anstieg. Hunderttausende Ausländer haben inzwischen einen Rechtsanspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft.
Offiziell sind die Voraussetzungen klar definiert: mindestens fünf Jahre rechtmäßiger Aufenthalt, gesicherter Lebensunterhalt, ausreichende Deutschkenntnisse und Wissen über die deutsche Rechts- und Gesellschaftsordnung. Nachgewiesen wird dies durch einen Multiple-Choice-Test und einen Sprachtest auf B1-Niveau.
Zweifel an echter Integration
Das Bundesinnenministerium mahnte kürzlich, bei «einer immer größeren Zahl von Antragstellern» sei festgestellt worden, dass «nur ein geringes beziehungsweise überhaupt kein inhaltliches Verständnis» der demokratischen Bekenntnisse vorhanden sei. Deswegen solle «grundsätzlich eine persönliche Vorsprache erfolgen».
Behördenmitarbeiter berichten von Bewerbern, die den Test bestanden haben, aber nicht erklären können, was sie geantwortet haben. Recherchen deckten auch gefälschte Sprachzertifikate auf. Nach Angaben von Bild liegen die Ablehnungsraten in deutschen Großstädten extrem niedrig: Berlin drei Prozent, Hamburg und München unter einem Prozent.
Sprachbarriere als Hauptproblem
«Theoretisch kann man von Einbürgerungswilligen erwarten, dass sie ein Gespräch über die Rechts- und Gesellschaftsordnung führen können», sagt der Sprachwissenschaftler Ibrahim Cindark. «In der Praxis zeigt sich jedoch das Problem, dass manche Personen zwar ein B1-Zertifikat erhalten, dieses Niveau aber tatsächlich nicht in Bezug auf alle möglichen Themen beherrschen.»
Nach seinen Studien reichen sechs Monate Integrationskurs nicht bei allen Teilnehmenden aus, um juristisch-politische Formulierungen zu verstehen. Hinzu kommen rechtliche Einschränkungen: Systematische Befragungen sieht das Staatsangehörigkeitsgesetz nach Expertenauffassung nicht vor.
Unterschiedliche Behördenpraxis
Die Praxis variiert stark zwischen den Bundesländern. In Berlin erfolgt eine Vorsprache meist erst vor der Urkundenübergabe, ähnlich in Hamburg oder Bayern. Andere Behörden führen stets Vorgespräche durch.
«Das Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig ist aus meiner Sicht vollkommen praxisfern», kritisiert Peter Schlotzer von der Einbürgerungsbehörde Darmstadt. «Wir können doch keine Personen einbürgern, die nicht verstanden haben, um was es geht.» Seine Behörde kündigt Gespräche vorab an, damit sich Antragsteller vorbereiten können.
Rechtliche Klärung steht aus
Der Bund plant derzeit keine weiteren Gesetzesänderungen, beobachtet aber die Entwicklung der Vollzugspraxis. Das Innenministerium hat seine Anwendungshinweise verschärft und empfiehlt nun selbst die persönliche Vorsprache.
Der Landkreis Peine hat gegen die Gerichtsentscheidung Rechtsmittel eingelegt. Eine grundsätzliche Klärung der strittigen Rechtsfragen steht somit in höheren Instanzen noch aus.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz überarbeitet.