Das Entsendeprogramm des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) unterstützt Organisationen der deutschen Minderheiten in Osteuropa und Zentralasien durch den Einsatz von Kulturmanager:innen und Redakteur:innen. Mit ihrem Fachwissen helfen sie nicht nur bei Projekten, sondern auch dabei, ein modernes Deutschland- und Europabild zu vermitteln und die kulturelle Vermittlerrolle der Organisationen zu stärken. Wir sprechen mit den Entsandten über ihre Aufgaben, Ziele und Beweggründe für diese interkulturelle Tätigkeit. Mit Johannes Schmidt, ifa-Kulturmanager beim Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz, sprach Victoria Matuschek.
 Johannes Schmidt (links), gemeinsam mit Lucjan Dzumla, Geschäftsführer des HDPZ.
Johannes Schmidt (links), gemeinsam mit Lucjan Dzumla, Geschäftsführer des HDPZ.Quelle: Johannes Schmidt
Wie bist du zum ifa-Entsendeprogramm gekommen – und warum gerade zum Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) in Gleiwitz?
Das war eigentlich ein längerer Weg. Ich habe – anders als viele andere im Entsendeprogramm – keinen direkten familiären Bezug zu Polen. Natürlich habe ich, wie viele Deutsche, eine Oma und einen Opa, die nach dem Krieg als Kinder aus Schlesien geflüchtet sind, aber das war in unserer Familie nie ein großes Thema. In meiner Jugend war ich nie in Polen, obwohl ich nur etwa 100 Kilometer von der Grenze entfernt in Sachsen aufgewachsen bin. Irgendwann habe ich mich dann gewundert: Warum fahren wir in den Urlaub nach Italien, Frankreich oder Spanien, aber nie nach Polen, das doch so nah ist?
Mein erster Kontakt mit Polen war mit 17 im Rahmen einer Klassenfahrt nach Danzig. Das hat mein Bild von Polen verändert. Viele Stereotype, die man unbewusst mitträgt, bestätigten sich dort nicht. Ich habe Polen als modernes, offenes Land erlebt. Schon immer habe ich mich für Politik, Kultur und andere Länder interessiert.
Als es nach einem längeren außereuropäischen Auslandsaufenthalt schließlich um die Studienwahl ging, wollte ich diese Interessen verbinden: In Chemnitz, das in diesem Jahr übrigens Europäische Kulturhauptstadt ist, habe ich deshalb Europastudien und Kulturwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf Ostmitteleuropa studiert.
Im Studium stand ich vor der Entscheidung, eine slawische Sprache zu lernen: Russisch, Tschechisch oder Polnisch. Die meisten meiner Kommiliton:innen wählten Russisch – sicher auch, weil es als „nützlichere“ Sprache galt. Aber ich habe oft das Bedürfnis, nicht das zu machen, was alle machen, und Russland reizte mich auch wenig. Polen hingegen fand ich spannend. Die vielschichtigen deutsch-polnischen Beziehungen interessierten mich, das Land bietet kulturell und landschaftlich viel: Meer, Berge, Städte – und ich kannte es alles kaum.
Also habe ich Polnisch gewählt, später ein Auslandssemester in Breslau absolviert – das war, als Breslau Kulturhauptstadt war – und ich habe dabei viel von der polnischen Kultur kennengelernt.
Nach diesem Studium trat das Polnische für eine Zeit in den Hintergrund. Ich habe einen Master anderswo im Ausland studiert und die polnische Sprache kaum genutzt. Dafür beschäftigte ich mich in dieser Zeit intensiv mit der Auswärtigen Kulturpolitik – und als mir bei der Jobsuche dann die Ausschreibung vom ifa ins Auge fiel, erinnerte ich mich wieder an mein in der Zwischenzeit etwas eingestaubtes Polnisch.
Das ifa kannte ich bereits, denn wenn man sich für internationale Kulturpolitik interessiert, sind einem Institutionen wie das ifa, der DAAD oder das Goethe-Institut ein Begriff. Die Stelle in Gleiwitz beim HDPZ hat mich besonders angesprochen, weil sie sehr vielseitig ist. Die Organisation ist stark mit der deutschen Minderheit verbunden, aber nicht darauf beschränkt. Das fand ich reizvoll: Dass man die deutsch-polnischen Beziehungen in ihrer ganzen Bandbreite bearbeiten kann, von Minderheitenarbeit über Jugendaustausch und Sprachförderung bis zu erinnerungspolitischen Projekten.
Wie sieht deine Arbeit als ifa-Kulturmanager aus? Welche Projekte gestaltest du mit oder bringst du selbst auf den Weg?
Das Spannende an unserer Arbeit ist, dass wir zwei Standorte haben – Oppeln und Gleiwitz. Ich bin im Büro Gleiwitz, wo wir ein kleines Team von vier Personen sind. Das bedeutet: sehr enge Abstimmung, viel Austausch über Projekte, gegenseitige Unterstützung – gleichzeitig arbeiten wir aber auch eng mit dem Büro in Oppeln zusammen.
In Gleiwitz liegt der Schwerpunkt stärker auf Kulturprojekten rund um das oberschlesische Kulturerbe sowie auf Sprachprojekten, z. B. im Rahmen von „Bilingua“, Schulpartnerschaften und sonstigen Sprachanimationen. Seit diesem Jahr koordinieren wir auch das neue Projekt Deutsches Kulturhaus Gleiwitz – mit zahlreichen Kulturveranstaltungen und Bildungsformaten.
Ich bin außerdem stark in internationale Kooperationen eingebunden. Besonders spannend finde ich die Arbeit an Projekten mit Partnern aus mehreren Ländern, weil sie viele unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Meine Rolle umfasst aber auch ganz praktische Dinge: Als einziger aus Deutschland entsandter Muttersprachler im Team bringe ich meine deutsche Sprachkompetenz ein – sei es beim Lektorieren, bei Anträgen, bei der Titelfindung von Veranstaltungen oder wenn es darum geht, deutsche Perspektiven in die Projektarbeit einfließen zu lassen. Ich versuche so auch, aktuelle Diskurse aus Deutschland sichtbar zu machen – Themen, die in Polen vielleicht nicht so präsent sind, aber relevant sein könnten.
 Brücken bauen durch Sprache: Johannes Schmidt leitet eine Sprachanimation für Schüler:innen.
Brücken bauen durch Sprache: Johannes Schmidt leitet eine Sprachanimation für Schüler:innen.Quelle: Johannes Schmidt
Seit drei Jahren bist du nun im Entsendeprogramm tätig – gibt es ein Projekt, auf das du besonders stolz bist?
Wie schon erwähnt, hatte ich auch die Gelegenheit, mit europäischen Partner:innen aus mehreren Ländern zusammenzuarbeiten, wofür ich sehr dankbar bin. So konnte ich unter anderem Projekte in Bosnien-Herzegowina sowie in Süditalien realisieren. Dabei ging es oft darum, mit Gruppen aus Deutschland, Polen und weiteren Ländern gemeinsam an verschiedenen Orten erinnerungspolitische Themen zu bearbeiten, die jeweiligen Erfahrungen auszutauschen und so das europäische Miteinander zu stärken. Diese multilaterale Zusammenarbeit bringt so viele neue Perspektiven ein und macht die Projekte vielschichtiger und spannender.
Ein Projekt, auf das ich jedoch besonders stolz bin, ist das Projekt „Stand with Ukrainbow“. Es war in vielerlei Hinsicht besonders: Wir wollten im deutsch-polnischen Kontext Solidarität mit der Ukraine zeigen – aber auch den Begriff von „Minderheit“ erweitern und gesellschaftspolitisch neu denken. Wir haben zivilgesellschaftliche Akteur:innen aus Deutschland, Polen und der Ukraine zusammengebracht, um sich über Minderheitenrechte auszutauschen – insbesondere im Hinblick auf queer und intersektionale Perspektiven.
Dabei wurden auch die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Ländern betrachtet: Während es in Polen unter der PiS-Regierung deutliche Rückschritte und eine Zunahme von Diskriminierungen gab, fand im ukrainischen Kontext nach Ausbruch des Krieges bspw. eine intensivierte Westorientierung statt, wodurch sich die Situation teilweise progressiver gestaltete, auch wenn z. B. für trans-Personen aufgrund des Krieges neue Diskriminierungsformen entstanden.
Der Austausch war intensiv: Die queeren Teilnehmenden hatten nicht nur verschiedene sexuelle und geschlechtliche Identitäten, sondern es befanden sich unter ihnen auch Geflüchtete, Personen mit Schwerbehinderung sowie Personen aus dem Oppelner Schlesien und der Kaschubei, also Regionen mit starken nationalen und ethnischen Minderheiten. Damit bestand fast die gesamte Gruppe aus Personen mit mehrfachen Marginalisierungserfahrungen. Gerade diese Vielfalt an Perspektiven hat das Projekt bereichert.
Es wurde deutlich: Identität ist nie eindimensional. Minderheitenerfahrungen sind vielschichtig. Nationale Zugehörigkeit ist immer nur ein Aspekt. Und diese Auseinandersetzung mit multidimensionaler Identität ließ die Teilnehmenden schließlich ein tieferes Verständnis auch für andere Diskriminierungserfahrungen entwickeln.
Das Projekt wurde auch mit dem Richeza-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Beim Abschlusstreffen war sogar Ministerpräsident Hendrik Wüst anwesend. Für mich war das ein inhaltlich sehr innovatives und wirksames Projekt.
 Solidarität sichtbar machen: Beim CSD in Oppeln treffen sich unterschiedliche Minderheitenperspektiven.
Solidarität sichtbar machen: Beim CSD in Oppeln treffen sich unterschiedliche Minderheitenperspektiven.Quelle: Johannes Schmidt
Das klingt wirklich nach einem besonderen und wichtigen Projekt. Da wir gerade beim Thema sind: Wie offen erlebst du die Region – insbesondere Gleiwitz – für gesellschaftspolitische Themen wie Diversität, Inklusion und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt?
Unsere Arbeit zielt ganz bewusst darauf ab, nicht nur innerhalb der deutschen Minderheit zu wirken. Wir wollen auch die Mehrheitsgesellschaft und andere Minderheiten ansprechen, somit muss die Auseinandersetzung mit Diversität immer auch ein zentraler Bestandteil unserer Tätigkeit sein.
In Gleiwitz ist die deutsche Minderheit zahlenmäßig kleiner als in Oppeln, aber dafür gibt es noch einige andere aktive Gruppen – wie etwa die schlesische Bewegung oder, durch die Lage in der Oberschlesischen Metropolregion, eine größere internationale Community. Diese Nähe zu verschiedenen Großstädten schafft durchaus ein progressiveres Umfeld mit einer Vielzahl an gesellschaftspolitischen Initiativen.
Mir ist wichtig: Minderheitenarbeit darf kein Konkurrenzkampf sein. Wir sollten stattdessen zu allen marginalisierten Gruppen Brücken bauen und Gemeinsamkeiten suchen, eine intersektionale Perspektive einnehmen. Wenn wir andere Minderheiten in unsere Aktivitäten einbeziehen – seien es nationale, sprachliche, geschlechtliche, sexuelle oder soziale – dann können wir viel voneinander lernen und miteinander solidarisch sein.
Das HDPZ hat sich immer dem Leitsatz verpflichtet gefühlt: „Gemeinsam sind wir stärker.“ Das spiegelt sich einerseits in dem Ansatz wider, dass wir mit verschiedenen Akteuren der deutsch-polnischen Beziehungen und der deutschen Minderheit zusammenarbeiten und zeigt sich auch in unserer Projektarbeit, die oft über die „typischen“ Themen der deutschen Minderheit hinausgeht – sei es beim Jugendgipfel des Regionalen Weimarer Dreiecks, bei EU-Projekten oder auch bei der Sprach- und Jugendarbeit.
„Identität ist vielschichtig – verschiedene Minderheitenperspektiven schaffen tieferes Verständnis für Diskriminierung.“
Die Vielfalt innerhalb von Minderheiten kann so sichtbar gemacht werden: niemand ist nur durch einen einzigen Aspekt seiner Identität geprägt. Jeder Mensch bringt unterschiedliche Interessen, Hobbys, Perspektiven und politische Anliegen mit, nimmt im Leben unterschiedliche soziale Rollen ein und ist durch vielfältige Erfahrungen geprägt.
Wenn wir in Projekten also gezielt Themen wie z. B. Demokratie, Feminismus oder Klimawandel in den Fokus nehmen, wenn wir über Gaming oder Popkultur sprechen und wenn wir Formate wie Poetry-Slams, Escape Rooms und Stadtspiele ausprobieren, dann erreichen wir damit auch diejenigen, die sich vielleicht nicht vordergründig für klassische Minderheitenthemen interessieren, sondern erst über diese Themen und Formate Kontakt zur Minderheit finden.
So entsteht ein Zugang, der persönliche Interessen mit der eigenen Minderheitenidentität verbindet – oft auf eine Weise, die den Menschen vorher so nicht bewusst war. Dadurch können wir ein breiteres Publikum ansprechen und zugleich zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere Gemeinschaft tatsächlich ist.
Du hast ja eben schon angedeutet, wie wichtig Offenheit in deiner Arbeit ist. Welche Tipps würdest du angehenden Kulturmanager:innen mitgeben – besonders für den Umgang mit sensiblen Themen im interkulturellen oder gesellschaftspolitischen Bereich, gerade in eher traditionell geprägten Kontexten?
Ich würde sagen, man sollte nichts von vornherein ausschließen, sondern für vieles offen sein. Ich habe hier sehr von Lucjan Dzumla, dem Geschäftsführer des HDPZ, gelernt. Er hat die Haltung: „Lass es uns ausprobieren“, oder sagt Dinge wie: „Spannend – lass uns mal schauen, was man daraus machen kann.“ Dieses Vertrauen in Ideen, in Projekte, in neue Formate, ist unglaublich wichtig.
Zweitens: Man muss sich bewusst sein, dass nicht jeder sofort dieselbe Sprache spricht wie man selbst, dass nicht jeder dasselbe Verständnis von Demokratie, Minderheitenarbeit oder Diversität hat. Wenn man dort ansetzt, wo Menschen bereits stehen, und nicht dort, wo man selbst gerne beginnen würde, kann man sehr viel bewirken.
Drittens: Geduld und Beobachtungsgabe sind entscheidend. Manche Themen brauchen Zeit, bis sie überhaupt besprochen werden können. Es ist oft wichtiger, zuzuhören, den Kontext zu verstehen und Schritt für Schritt Brücken zu bauen, als sofort große Debatten zu führen.
Und schließlich: Humor nicht vergessen. Gerade bei schwierigen Themen oder bei Missverständnissen hilft eine kleine humorvolle Herangehensweise oft, Spannungen abzubauen und Gespräche auf eine konstruktive Ebene zu bringen.
 Johannes Schmidt unterwegs in Oberschlesien – mit dem Cabrio auf der Suche nach Spuren des kulturellen Erbes.
Johannes Schmidt unterwegs in Oberschlesien – mit dem Cabrio auf der Suche nach Spuren des kulturellen Erbes.Quelle: Johannes Schmidt
Zum Abschluss noch eine persönlichere Frage: Du wohnst nicht direkt in Gleiwitz, sondern im nahen Kattowitz – was schätzt du an der Stadt und der Region besonders?
In der Oberschlesischen Metropolregion gehen die Städte nahtlos ineinander über, sodass man die Grenzen kaum bemerkt. Kattowitz liegt etwas östlicher und ist vielen aus der deutschen Minderheit weniger vertraut – oft richtet sich der Blick stärker auf Oppeln oder ländliche Gegenden. Gerade weil Kattowitz am Rand der historischen Region liegt, finde ich es spannend: Hier treffen unterschiedliche Entwicklungslinien Polens aufeinander, und die Stadt ist heute ausgesprochen multikulturell.
Kattowitz gilt heute als Hauptstadt Schlesiens. Die Region erinnert stark ans Ruhrgebiet: Junge Städte, groß geworden durch Kohleförderung, die sich nun in Kulturzentren verwandeln. Besonders sichtbar ist das in der „Strefa Kultury“ mit Museum, Kongresszentrum und Orchester. Wo früher Gruben waren, wachsen Hochhäuser, alte Industriehallen werden zu Kulturorten. Ich sage gern: Kattowitz steckt in der Pubertät – launisch, energiegeladen und täglich erwachsener.
Zugleich wird die Stadt grüner. Mitten im Industriegebiet liegt einer der größten Stadtparks Europas. Statt klassischer Sehenswürdigkeiten wie in Krakau oder Breslau gibt es hier Arbeitersiedlungen, Bergwerke, Bunker und Spuren deutschen Kulturerbes. Im Umland warten Burgen, Paläste, die Błędów-Wüste und die nahen Beskiden.
Mein Hobby ist es, diese Kuriositäten aufzuspüren – oft im Cabrio, einfach drauflos. Und ich bin überzeugt: Wer genau hinsieht, entdeckt hier überall Spannendes.
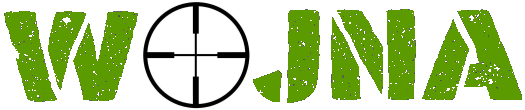








!["Obszar śmierci". To najważniejszy moment wojny. Były amerykański dowódca: Putin zapędził się w ślepą uliczkę [OPINIA]](https://cdn.wiadomosci.onet.pl/1/kqUk9lBaHR0cHM6Ly9vY2RuLmV1L3B1bHNjbXMvTURBXy9kZmQzOTNlZGI1ZGQwZWQwMDE1ZmZlNTY2MDczYTYzZC5qcGeSlQMAAM0HgM0EOJMFzQlgzQZA3gACoTAHoTEE)





![Tysiące płomieni rozświetliło bełchatowski cmentarz. Zobacz, jak wyglądała nekropolia wieczorową porą [FOTO]](https://storage.googleapis.com/patrykslezak-pbem/belchatow/articles/image/8766ecca-340f-453f-8f97-cec19e94b905)

