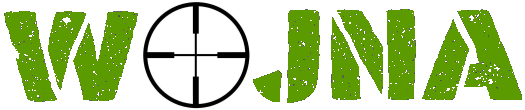Astronomen erwarten eine gewaltige Explosion am derzeit unscheinbaren Stern T Coronae Borealis. Seine Helligkeit soll dabei um mehr als das 1.000-fache ansteigen - so stark, dass er tagelang mit bloßem Auge sichtbar wird und etwa so hell leuchtet wie der Polarstern.
Doch seit anderthalb Jahren warten Forscher und Hobby-Astronomen vergeblich auf das spektakuläre Aufleuchten. Ursprünglich sagten sie den Ausbruch für Februar 2024 vorher, dann für April und schließlich für den Herbst 2024.
«Es war von Anfang an falsch, einen Zeitpunkt für den Ausbruch vorherzusagen», sagt der Astrophysiker Ulisse Munari von der Universität Padua. «Wir wissen zwar, dass die letzten Ausbrüche etwa 80 Jahre auseinander lagen - aber der Rest ist Spekulation. Es steht nirgends geschrieben, dass die Ausbrüche immer 80 Jahre auseinander liegen.»
Das Doppelsternsystem
T Coronae Borealis ist eine sogenannte wiederkehrende Nova - ein Doppelsternsystem aus einem aufgeblähten Roten Riesen und einem erdgroßen Weißen Zwerg. Die beiden Sterne umkreisen sich in etwa halber Entfernung zwischen Erde und Sonne.
Der Riesenstern stößt ständig Wasserstoff ab, der sich auf dem Weißen Zwerg ansammelt. Wenn genügend Material zusammenkommt, explodiert der Wasserstoff thermonuklear - der Stern leuchtet für wenige Tage 1.000 bis 3.000 Mal heller auf.
Geschichte der Beobachtungen
Der irische Astronom John Birmingham berichtete 1866 erstmals über einen Helligkeitsausbruch von T CrB. Nach einem weiteren Aufleuchten 1946 vermuteten Forscher regelmäßige Ausbrüche alle 80 Jahre.
Tatsächlich fanden sich in historischen Aufzeichnungen Beobachtungen einer Nova in der Nördlichen Krone für die Jahre 1788 und sogar 1217. Die zeitlichen Abstände schwanken allerdings zwischen 78 und 81 Jahren.
Warum die Prognosen falsch lagen
Das Problem liegt beim unberechenbaren Massentransfer zwischen den Sternen. «Dieser Massentransfer ist sehr variabel und auch noch nicht zu hundert Prozent verstanden», erklärt Nova-Expertin Veronika Schaffenroth von der Thüringer Landessternwarte. Pro Sekunde strömen im Mittel etwa 600 Milliarden Tonnen Wasserstoff auf den Weißen Zwerg.
Beobachtungen zwischen 2017 und 2023 zeigen, dass der Zustrom geringer war als vor dem letzten Ausbruch 1946. «Ich wäre nicht überrascht, wenn es erst 2026 oder sogar 2027 zu einem Ausbruch kommt», betont Sumner Starrfield von der Arizona State University.
Hobby-Astronomen können das Sternbild Nördliche Krone zwischen Bootes und Herkules im Auge behalten. Seine sieben hellsten Sterne bilden einen kleinen Halbkreis - der griechischen Sage nach die mit Edelsteinen besetzte Krone von Ariadne.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz überarbeitet.