Mit Knut Abraham, dem Koordinator für die deutsch-polnische zivilgesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland, sprach Andrea Polanski über seine neuen Aufgaben, die Prioritäten der Bundesregierung im Verhältnis zu Polen, aktuelle Herausforderungen in den bilateralen Beziehungen und die Rolle der deutschen Minderheit in Polen.
Herr Abraham, seit unserem letzten Gespräch im September 2024 hat sich einiges getan: Sie sind nun der neue Koordinator der Bundesregierung für die zivilgesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit mit Polen. Wie blicken Sie auf diese neue Aufgabe – was sind Ihre zentralen Prioritäten?
Es ist mir eine große Ehre, das Amt des Koordinators übernehmen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass in diesen Zeiten, in denen es auf Deutschland und Polen ankommt, die Zivilgesellschaft und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zu unseren bilateralen Beziehungen leisten können. Bereits kurz nach meinem Amtsantritt konnte ich beim Deutsch-Polnischen Forum sprechen. So verstehe ich auch meine Aufgabe – als eine Art „permanentes Deutsch-Polnisches Forum“: im kontinuierlichen Austausch mit den Akteuren und als wichtiger Fürsprecher für ihre Anliegen im politischen Berlin.
Was die Prioritäten angeht, so haben wir hier im Koalitionsvertrag, an dem ich mitgearbeitet habe, bereits erste Pflöcke eingeschlagen: zügiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nach Polen, rasche Errichtung des Gedenkorts Polen und des Deutsch-Polnischen Hauses sowie die Stärkung wesentlicher bilateraler Institutionen wie z. B. der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Übrigens haben wir uns auch zur Fortführung der Förderung der deutschen Minderheit in Mittel- und Osteuropa verpflichtet. Für all das werde ich mich als Koordinator nachhaltig einsetzen.
 Foto: Andrea Polanski
Foto: Andrea PolanskiSie verfolgen die Entwicklungen zwischen Polen und Deutschland bereits seit der Zeit der „Solidarność“-Bewegung. Wie würden Sie den Zustand der bilateralen Beziehungen damals beschreiben – und was hat sich seitdem grundlegend verändert?
Das geteilte Deutschland und das Polen der 80er Jahre waren andere Länder als heute. Ich erinnere mich noch gut an unsere Bewunderung für die Solidarność-Bewegung. Ich habe damals selbst Hilfsgüter nach Polen gebracht und bin bis heute sehr dankbar dafür, welche große Rolle diese Bewegung beim Fall des Eisernen Vorhangs und als Inspiration für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR gespielt hat. Heute sind wir nicht nur als Nachbarn wirtschaftlich, menschlich und kulturell aufs Engste miteinander verbunden, sondern auch Partner und Verbündete in der EU und NATO. Nächstes Jahr werden wir bereits den 35. Jahrestag unseres Nachbarschaftsvertrags von 1991 begehen. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die ich in den 80er Jahren auf dem Weg nach Polen nicht in meinen kühnsten Träumen für möglich gehalten hätte.
In beiden Ländern war in den letzten Monaten einiges los. In Deutschland ist Friedrich Merz neuer Bundeskanzler, in Polen wurde ein Präsident gewählt, der – wie auch seine unterstützende Partei – stark antideutsche Töne anschlägt. Welche Auswirkungen hat dieser Wandel auf die bilateralen Beziehungen?
Kanzler Merz hat bereits im Wahlkampf klargemacht, wie wichtig ihm die deutsch-polnischen Beziehungen sind. Nicht umsonst ging seine Antrittsreise direkt nach der Vereidigung nach Paris und Warschau, zu unseren wichtigsten europäischen Partnern. Wir werden auf unserer Seite alles tun, um weiterhin im engen Dialog mit der polnischen Regierung zu bleiben und mit ihr vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Knut Abraham über die deutsche Minderheit in Polen: „Eine Rolle, die nicht immer einfach, aber unverzichtbar ist.“
Deutschland und Polen sind innenpolitisch tief gespalten. Gibt es im deutsch-polnischen Dialog Themen, die über diese Spaltungen hinwegtragen? Was sollte Ihrer Meinung nach unbedingt gepflegt und geschützt werden?
Deutschland und Polen sind zentrale Eckpfeiler der Europäischen Union. Diese zu schützen und fortzuentwickeln ist eine ganz große gemeinsame Aufgabe. Zudem: die Unterstützung der Ukraine und der Kampf gegen den russischen Imperialismus und für unsere eigene Sicherheit in Europa! Die Geschichte wird uns nicht vergeben, wenn wir uns hier von engen, innenpolitischen Erwägungen dominieren lassen.
Was sind aus Sicht der Bundesregierung nun ganz konkrete Vorhaben, um im Verhältnis zu Polen den nächsten Schritt zu gehen – jenseits der Symbolik?
Ich weiß, dass wir quer über alle Ministerien hinweg im engen Austausch mit unseren polnischen Partnern über konkrete gemeinsame Projekte sind – davon zeugt auch der Aktionsplan, den unsere beiden Regierungen 2024 erarbeitet haben. Aus meiner Sicht ist jetzt eines der wichtigsten konkreten Vorhaben der oben bereits erwähnte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Diese ist entscheidend für einen reibungslosen Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr in unserem Verflechtungsraum, für die logistische Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine sowie für die Sicherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit.
Sie haben vorher das Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs erwähnt. Derzeit steht lediglich ein provisorischer Gedenkstein in Berlin. Kritiker – vor allem aus dem rechten politischen Lager in Polen – sprechen von einem „bloßen Stein“. Wie ist hier der Stand der Dinge? Gibt es bereits einen klaren Fahrplan für das eigentliche Denkmal und das geplante Deutsch-Polnische Haus? Wie lange bleibt der „Stein“ ein Provisorium?
Außenminister Wadephul hat beim Deutsch-Polnischen Forum klar ausgesprochen, worum es geht: Die Versöhnung ist ein „Geschenk“, das wir Deutsche nicht erwarten konnten. Wir haben uns deswegen im Koalitionsvertrag auch klar zum Gedenkort Polen und zum Deutsch-Polnischen Haus bekannt. Das sind für mich die wichtigsten erinnerungspolitischen Vorhaben in dieser Legislaturperiode! Der provisorische Gedenkort, der vor Kurzem im Beisein der polnischen Kulturministerin und des deutschen Kulturstaatsministers eingeweiht wurde, ist ein wichtiger Schritt. Der Standort im Herzen Berlins, neben dem Kanzleramt und direkt gegenüber dem Bundestag, am Platz der ehemaligen Krolloper, verdeutlicht die Bedeutung, die wir dem Gedenken an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus und der deutschen Besatzung in Polen beimessen. Die Initiative, konkret der Realisierungsvorschlag für das Deutsch-Polnische Haus, liegt nun wieder in den Händen des Bundestags. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir zeitnah zu einer Entscheidung kommen werden.
 Der Gedenkort für Polen 1939–1945 befindet sich direkt neben dem Kanzleramt und gegenüber dem Bundestag.
Der Gedenkort für Polen 1939–1945 befindet sich direkt neben dem Kanzleramt und gegenüber dem Bundestag.Foto: Andrea Polanski/Archiv
In der polnischen Öffentlichkeit wird vielfach kritisiert, dass Deutschland zu wenig Reue zeige. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte „humanitäre Geste“ gegenüber noch lebenden polnischen NS-Opfern steht bislang aus. Wie reagieren Sie auf den Vorwurf, der provisorische Gedenkstein sei ein Versuch, berechtigte polnische Forderungen nach Erinnerung und Wiedergutmachung abzuschwächen?
Dazu hat Bundeskanzler Merz bereits bei seinem Antrittsbesuch in Warschau klare Worte gefunden: Wir Deutsche haben im Zweiten Weltkrieg und durch die Besatzungsherrschaft unermessliches Leid über unsere polnischen Nachbarn gebracht. Die große Verantwortung, die aus dieser Schuld erwächst, bleibt bestehen; wir nehmen sie ernst und nehmen sie an.
Unabhängig von politischen Spannungen – wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die alltägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das Engagement der Menschen in den Regionen, etwa auch der deutschen Minderheit in Polen, für stabile deutsch-polnische Beziehungen?
Lassen Sie mich sagen, wie wohl ich mich fühle, wenn ich bei Gruppen der Minderheit zu Gast bin. Diesen schönen direkten persönlichen Kontakt habe ich seit September 1989, als ich in Oberschlesien in vielen Orten zu Gast bei den sich bildenden Deutschen Freundschaftskreisen war. Wertvolle Freundschaften sind entstanden. Das Wort „wichtig“ allein wird der Bedeutung des Engagements der Minderheit nicht gerecht. Der deutsch-polnische Verflechtungsraum und die Menschen in den Regionen, die sich für unsere Beziehungen einsetzen, sind das Rückgrat unserer Beziehungen – ohne sie geht es nicht. Die deutsche Minderheit ist für mich eine unersetzbare Brückenbauerin zwischen unseren beiden Ländern. Eine Rolle, die nicht immer einfach, aber unverzichtbar ist.
Sie sind viel im Land unterwegs, um mit zivilgesellschaftlichen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Gibt es auch Überlegungen oder bereits Pläne, die deutsche Minderheit in Polen zu besuchen und sich vor Ort ein Bild von ihrer Arbeit und den aktuellen Herausforderungen zu machen?
Bereits in meiner ersten Woche als Koordinator habe ich mich mit Vertretern der deutschen Minderheit getroffen, nämlich mit Herrn Bartek, Herrn Gaida und Frau Hassa. Dieser Austausch ist mir sehr wichtig. Nicht umsonst bin ich auch Mitglied im Parlamentskreis „Minderheiten“. Und natürlich werde ich auch zeitnah bei Ihnen vor Ort sein. Darauf freue ich mich schon jetzt ganz besonders!
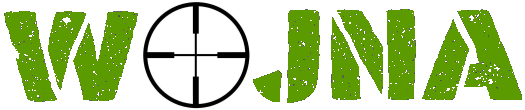





![Dyktatorzy nie chcą umierać. Na naszych oczach toczy się nowe starcie Wschodu i Zachodu. Stawką jest wolność i... nieśmiertelność [OPINIA]](https://cdn.wiadomosci.onet.pl/1/NuYk9lBaHR0cHM6Ly9vY2RuLmV1L3B1bHNjbXMvTURBXy8yYzM4ZWIyMmFkZTdlYWVmZTY1MDZiNmM5ZWFlM2Q3Yi5qcGeTlQMAAM0KAM0FoJMFzQlgzQTslQfZjGh0dHBzOi8vY2RuLndpYWRvbW9zY2kub25ldC5wbC8xL3VicGs5azdhSFIwY0hNNkx5OWpaRzR1ZDJsaFpHOXRiM05qYVM1dmJtVjBMbkJzTDJsdFp5OXNiMmR2WDI5dVpYUmZkMmxoWkc5dGIzTmphUzV3Ym1lUmxRSUFaTVBEM2dBQ29UQUhvVEVFCMIA3gACoTAHoTEE)




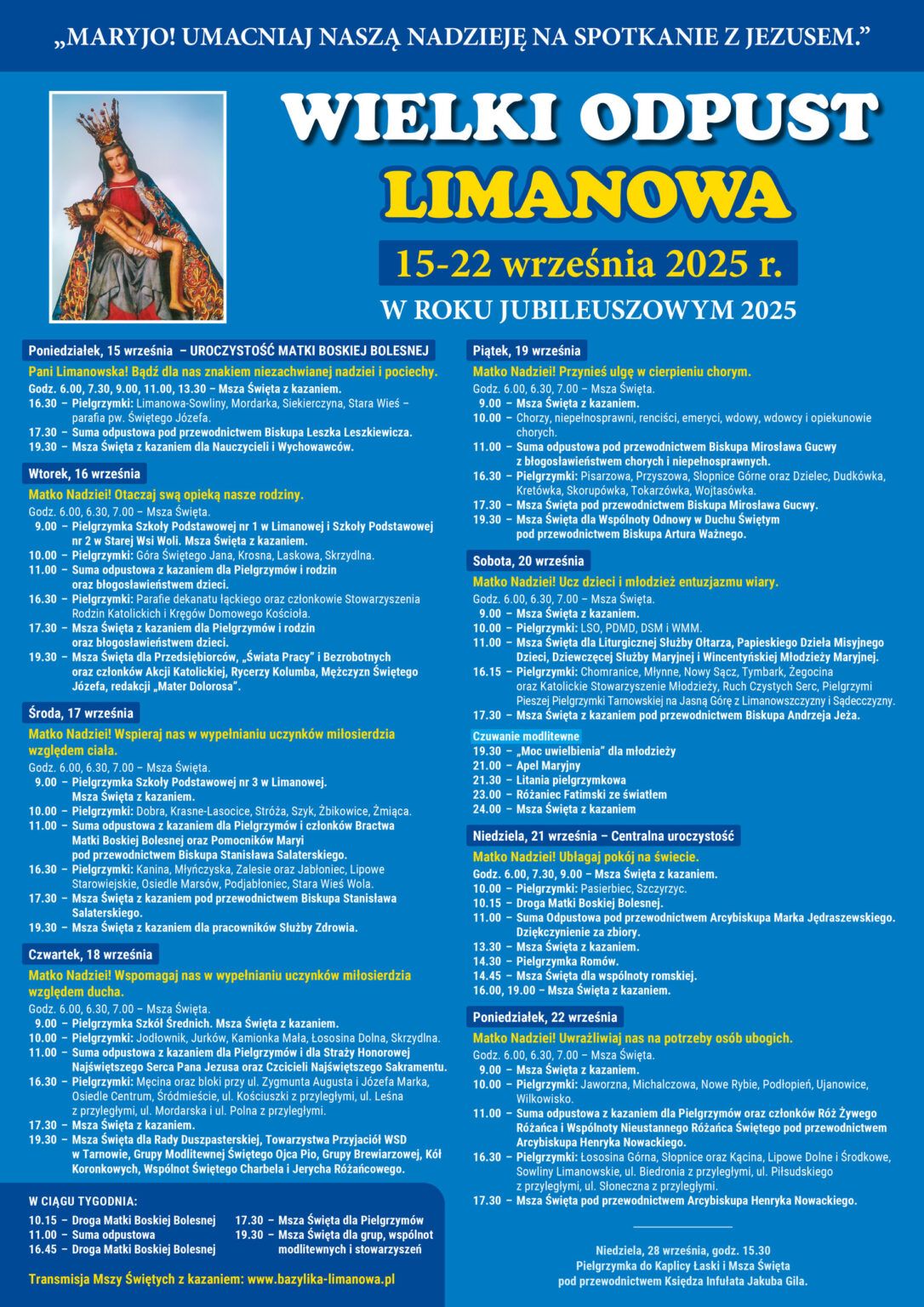
![Piknik rodzinny z KGW "Troszynianki" [ZDJĘCIA]](https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/zdjecia/2025/klvwz8hu.jpeg)
![Pozytywny akcent w przestrzeni publicznej. Tak to się robi w Wydmusach! [ZDJĘCIA]](https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/zdjecia/2025/547337953_1385636000231492_3298306702627804447_n.jpg)



