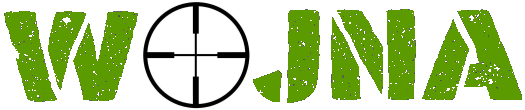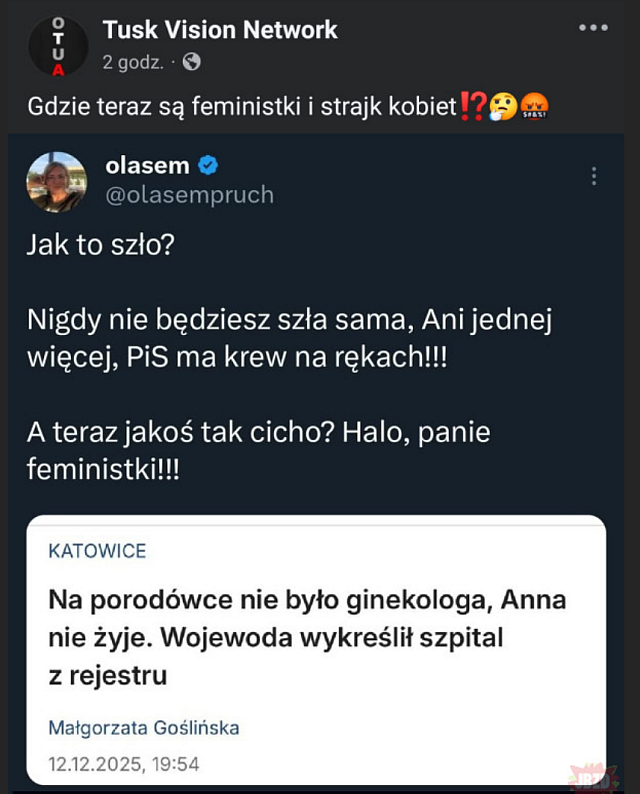Rabatte, Bonusaktionen und Bestpreisgarantien gehören zum Alltag im Handel. Doch Unternehmen müssen beim Werben mit Preisvorteilen strenge rechtliche Vorgaben beachten. Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet heute seine Entscheidung in einem Rechtsstreit über eine Kaffee-Werbung des Lebensmitteldiscounters Netto.
Die Preisangabenverordnung regelt, wie Händler ihre Preise gegenüber Verbrauchern angeben müssen. Unternehmen sind verpflichtet, den Gesamtpreis inklusive Umsatzsteuer anzugeben. Bei verpackten Waren nach Gewicht, Volumen oder Fläche muss zusätzlich der Grundpreis pro Mengeneinheit genannt werden.
Strikte Regeln gegen irreführende Werbung
Preisrabatte dürfen Verbraucher nicht in die Irre führen, erklärt Rechtsanwalt Martin Jaschinski von der Berliner Kanzlei JBB Rechtsanwälte. Problematisch wird es bei falschen Ursprungspreisen, die nie so hoch waren wie behauptet. «Das passiert gar nicht mal so selten», sagt der Werberechtsexperte.
Eine weitere umstrittene Methode ist die Preisschaukel. Dabei setzen Unternehmen den Preis kurzzeitig hoch, um anschließend mit einem vermeintlichen Rabatt zu werben. Wer nur für eine «unangemessen kurze Zeit» den höheren Preis verlangt, darf danach nicht mit einer Preisherabsetzung werben, so Jaschinski.
Um solche Praktiken zu verhindern, legte die Europäische Union eine klare Regel fest. Bei jeder Werbung mit Preisermäßigung muss der niedrigste Preis der letzten 30 Tage vor der Reduzierung angegeben werden - der sogenannte Referenzpreis.
BGH entscheidet über Netto-Werbung
Der Europäische Gerichtshof stellte im September klar: Prozentuale Rabatte müssen sich immer auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage beziehen. Es reicht nicht, den Referenzpreis nur in einer Fußnote zu erwähnen, während sich die Werbung auf einen höheren Preis bezieht.
Die Wettbewerbszentrale klagte gegen Netto Marken-Discount aus Bayern wegen einer Kaffee-Werbung. Das Unternehmen warb mit einem Preis der Vorwoche von 6,99 Euro, einem aktuellen Preis von 4,44 Euro und einem Rabatt von 36 Prozent. Der in der Fußnote genannte Referenzpreis lag jedoch ebenfalls bei 4,44 Euro - also genauso hoch wie der vermeintlich reduzierte Preis.
Unternehmen weichen auf UVP-Werbung aus
Seit dem EuGH-Urteil werben Unternehmen seltener mit Preisermäßigungen und häufiger mit unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP), beobachtet Jaschinski. Für UVP-Werbung gelten die strengen Regeln der Preisangabenverordnung nicht, da hier der vom Hersteller empfohlene Preis als Vergleich dient.
«Ob sie das als UVP- oder als wirkliche Preisherabsetzung bewerben, ist für Verbraucher aber häufig gar nicht so leicht erkennbar», warnt der Berliner Anwalt. Problematisch sei zudem, dass UVP oft nicht seriös kalkuliert würden und weit über den tatsächlichen Verkaufspreisen lägen. «Da wird es noch viel Streitstoff geben», ist sich Jaschinski sicher.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz überarbeitet.