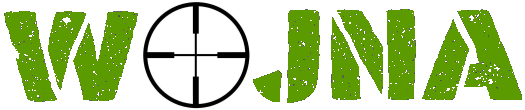Im Rahmen der Reihe „Die Frau und der Krieg“ organisiert das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen (DAZ) verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen. Mit Iga Nowicz, ifa-Kulturmanagerin beim DAZ, sprach Victoria Matuschek über den bevorstehenden Workshop und die Podiumsdiskussion zum Thema „Gelöschte Erinnerungen. Warum ist es so schwer, über das Jahr 1945 zu sprechen?“
Wie ist die Idee zu den Veranstaltungen entstanden?
Das Jahr 2025 ist das Jahr, in dem an die oberschlesische Tragödie erinnert wird. Wir wollten eine Veranstaltung schaffen, die die Rolle der Frauen im Krieg in den Fokus stellt und eine andere Sicht auf den Krieg bietet. Dazu gehören zwei Ausstellungen: „Kreuz im Schatten der Diktaturen“ und „Sie kämpfen, sie behandeln, sie retten“, die Ausstellung zu den Frauen im Ukraine-Krieg. Wir wollten auch das Thema Gewalt an Frauen und sexualisierte Gewalt als Teil der Kriegsführung ansprechen, ein schwieriges und oft tabuisiertes Thema.
Habt ihr Herausforderungen bei der Quellen- und Expertensuche erlebt?
Auch wenn kriegsbedingte sexualisierte Gewalt immer wichtiger für Wissenschaftler:innen wird, haben wir nur Schätzungen, was das tatsächliche Ausmaß der Vergewaltigungen 1945 betrifft. Viele Frauen, die direkt betroffen waren, wollten nicht sprechen, was die Forschung natürlich erschwert. Der bekannte deutsche Film „BeFreier und Befreite“ von Helke Sander thematisiert zum Beispiel die Schwangerschaften deutscher Frauen durch russische Soldaten, was Hinweise auf die Häufigkeit solcher Vorfälle liefert. In der deutschen Erinnerungskultur ist das Thema seit den 2000er Jahren präsenter geworden, beispielsweise durch die Wiederveröffentlichung des Buches „Eine Frau in Berlin“ 2003 oder Romane wie „Die Mittagsfrau“ von Julia Franck (neulich verfilmt) oder „Heimsuchung“ von Jenny Erpenbeck. Deshalb haben wir eine Literaturwissenschaftlerin eingeladen, die Germanistin ist und sich mit dem Thema in Deutschland beschäftigt. Wir wollen die Unterschiede in der deutschen und polnischen Erinnerungskultur reflektieren, was sexualisierte Gewalt an Frauen betrifft.
 Iga Nowicz, ifa-Kulturmanagerin beim DAZ: „Erinnerungskultur kann Narrative verfestigen – aber auch neue Perspektiven eröffnen.“
Iga Nowicz, ifa-Kulturmanagerin beim DAZ: „Erinnerungskultur kann Narrative verfestigen – aber auch neue Perspektiven eröffnen.“Inwiefern gibt es hier Unterschiede?
In Polen und Deutschland gab es lange unterschiedliche Erinnerungskulturen, auch was die Erinnerung an die Sowjetunion und die Rote Armee betrifft. In Ostdeutschland und Polen war es politisch nicht erlaubt, über Verbrechen der Sowjetarmee zu sprechen. Was die Erinnerung an den Krieg als Ganzes betrifft, dominiert in Polen oft die Opferrolle, während in Deutschland die Täterrolle im Vordergrund steht. Und da ist natürlich die Frage: was machen wir mit einem solchen Thema, das gewissermaßen die Grenzen sprengt, und das Leiden der deutschen Zivilbevölkerung anspricht?
Gibt es Parallelen zwischen dem Thema „Die Frau im Krieg 1945“ und der aktuellen Situation in der Ukraine, zu der ihr auch eine Ausstellung organisiert habt?
Verschiedene Formen von Gewalt, darunter natürlich auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Männer, werden auch im russischen Krieg gegen Ukraine systematisch eingesetzt. Die Ausstellung zur Ukraine zeigt aber, dass Frauen nicht nur passive Opfer sind, sondern auch aktiv in der Armee tätig sind oder sich für andere einsetzen. Wir möchten vermeiden, dass Frauen nur als Opfer wahrgenommen werden, da ihre Rolle natürlich viel komplizierter ist. In der Ukraine mussten Frauen sich das Recht erkämpfen, militärisch tätig zu werden, was 2014 noch nicht selbstverständlich war. Das Thema umfasst auch die Betrachtung unserer Vorstellungen von Krieg, Konflikt und Geschlechterrollen.
Inwiefern betrifft das Thema auch Männer und junge Menschen?
Gewalt an Frauen ist ein Thema, das nicht nur Frauen betrifft. Als menschliches Thema betrachtet, ist es auf jeden Fall für alle wichtig. Die Ereignisse 1945 hatten gravierende Folgen für ganze Familien und Gemeinschaften, die bis heute andauern, einschließlich transgenerationalem Trauma. Für die Jugend ist diese Thematik nicht einfach, es ist aber wichtig, auch junge Menschen für diese Geschichte zu sensibilisieren. Und wir wollen uns mit der unserer Wahrnehmung der Vergangenheit befassen, auch mit den Bildern, die wir im Kopf haben, wenn wir über das Schicksal von Frauen reden. Das ist für junge Menschen höchst relevant.
Welche Rolle spielen persönliche Erzählungen und Zeitzeugenberichte in der heutigen Erinnerungskultur? Und siehst du einen Wandel in der Erinnerungskultur?
Wir haben heute immer noch die Möglichkeit, mit Menschen zu reden, die zum Beispiel aus Schlesien fliehen mussten. Solche Gespräche können uns ein anderes Verständnis von Zeit, Ort, Heimat und Zugehörigkeit ermöglichen, da diese komplexen Erfahrungen oft nicht den gängigen Diskursen entsprechen. Aus diesem Grund wollten wir die Stimmen aus der Vergangenheit in unserem Workshop zum Klingen bringen und autobiografische Texte behandeln, und sie in ihrem besonderen Kontext verorten. Wenn wir deutsche Texte aus den 1940er Jahren lesen, fällt auf, dass eine kritische Analyse des Nationalsozialismus fehlt. Auch aus diesem Grund ist es spannend, aus heutiger Sicht zu sehen, wie die Texte die Gedanken der Menschen damals widerspiegeln.
Inwiefern kann die Erinnerung an kriegsbedingte sexualisierte Gewalt unser Verständnis der Vergangenheit verändern?
Das Thema erfordert die Bereitschaft, mit Komplexität und Ambivalenz umzugehen und die Erinnerung an das kriegsbedingte Leiden mit dem Bewusstsein der deutschen Verantwortung für den Krieg koexistieren zu lassen. Wie können wir solche Widersprüche vereinbaren? Zum Beispiel war eine deutsche Frau im Dritten Reich natürlich nicht unschuldig, da sie möglicherweise vom dem Regime profitiert hatte oder ideologisch mit der Nazi-Herrschaft einverstanden war. Wenn sie vergewaltigt wurde, war sie Opfer, während sie in anderen Kontexten aber als Komplizin betrachtet werden kann. Solche Widersprüche sind interessant, da sie auch heute noch relevant sind.
„Frauen waren nicht nur Leidtragende des Krieges, sondern auch Mitwirkende – diese Mehrdimensionalität wird oft übersehen.“
Ich finde das Thema spannend, weil es, wie du bereits meintest, nicht linear ist, im Gegensatz dazu, was oft in Geschichtsbüchern thematisiert wird. Deutschland und Polen haben einen unterschiedlichen Bezug zum Ende des Zweiten Weltkrieges und zur Nachkriegszeit. Kann das DAZ als eine Institution, die sich mit der Geschichte der deutschen Minderheit in Polen befasst, eine Vernetzungsarbeit leisten und die gemeinsame Erinnerungskultur von Deutschland und Polen fördern? Wie siehst du die Relevanz dieser Zusammenarbeit für die Erinnerungskultur?
Wir haben bei unseren Veranstaltungen eher eine äußere Sicht auf Deutschland, da die Historikerinnen Joanna Hytrek-Hryciuk und Bogusław Tracz aus Polen kommen und die Literaturwissenschaftlerin Katherine Stone aus Großbritannien stammt. Diese Vielfalt ermöglicht es uns aber auch, unerwartete Verbindungen aufzuzeigen und Vergleiche anzustellen. Und natürlich sind sie alle Expertinnen auf ihrem Gebiet. Für Katherine Stone ist diese Region auch sehr spannend und sie möchte auch gerne selbst Fragen stellen und erfahren, wie die Menschen vor Ort mit der Vergangenheit umgehen.
In Deutschland wurde das Leiden der Deutschen im Krieg erst seit den neunziger Jahren thematisiert, mit der Bombardierung, Vertreibung und den Massenvergewaltigungen. Das sind auch Themen der deutschen Minderheiten, die mit dem Schicksal von Vertreibung und Flucht konfrontiert waren und damit verbunden natürlich auch die Frage, wie lässt sich das vereinbaren mit der Täterrolle im Nationalsozialismus? Diese Frage sollten wir nicht meiden, wir müssen über beides sprechen. Ich glaube, wir sollen genug Raum für unterschiedliche Erinnerungen schaffen, ohne starre Denkmuster zu bedienen, um eine zukunftsfähige, differenzierte und offene Erinnerungskultur zu schaffen.
Deine Ansätze zur Erinnerungskultur erinnern mich an den französischen Wissenschaftler Glissant und seine Theorie der „Opacity“, die im Grunde besagt, dass man nicht alles verstehen muss, um es zu akzeptieren. Ich denke, wir brauchen mehr solche Ansätze in der Kulturpolitik, die die Koexistenz verschiedener Perspektiven ermöglichen und starre Denkmuster vermeiden. Denkst du, dass wir eine solche Erinnerungskultur benötigen, die diese Vielfalt berücksichtigt? Und inwiefern ist das auch für die deutsche Minderheit relevant?
Ich denke, wir brauchen eine Erinnerungskultur, die pluridimensional und weltoffen ist. Deshalb finde ich es immer spannend, wenn vergessene Gruppen oder Geschichten untersucht werden. Historiker:innen sollten die Stimmen aus der Vergangenheit mit Respekt und ohne Vorurteile betrachten, insbesondere wenn es um Menschen geht, die sowohl Opfer als auch Täter waren. Die deutsche Minderheit hat Zugang zu dieser pluridimensionalen Identität und kann diese komplexe Geschichte reflektieren und bewahren. Die Welt ändert sich, und – wie ich schon gesagt habe – wir müssen Platz schaffen für unerwartete Geschichten, die wir noch nicht gehört haben. Wir brauchen die Grundlage der historischen Tatsachen, aber wir müssen auch reflektieren, dass Geschichte oft politisiert und verschieden interpretiert wird. Diese Interpretationen können neu bewertet werden, ohne ideologisch vereinnahmt zu werden. Ich glaube, wir brauchen flexibles Denken, und vielleicht kann die deutsche Minderheit das durch ihre einzigartige Lage leisten.
Der Workshop findet am 09.04. von 14:30 bis 16:30 Uhr statt, Anmeldung unter [email protected] oder telefonisch unter +48 77 407 50 12.
Die Paneldiskussion mit Expertinnen und Experten findet am 09.04. von 17 bis 19 Uhr im DAZ statt. Die Veranstaltungen sind zweisprachig und die Teilnahme ist kostenlos.
Das Projekt findet in Kooperation mit dem Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) statt und wird vom ifa – Institut für Auslandsbeziehungen e.V. aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.