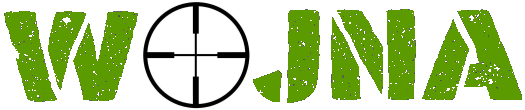Vor 80 Jahren kapituliert das japanische Kaiserreich nach sechs Jahren brutalen Krieges. Die fanatischen Durchhalteparolen sitzen so tief, dass hochrangige Militärs noch in der Nacht vor der Kapitulation einen Staatsstreich versuchen. Ein Soldat kämpft sogar bis 1974 weiter.
Während der Zweite Weltkrieg in Europa am 8. Mai 1945 mit der deutschen Kapitulation endet, tobt im Pazifik der Kampf gegen das japanische Kaiserreich weiter. Ähnlich wie das nationalsozialistische Regime propagieren auch Kaiser Hirohito und seine Militärspitze unablässig Durchhalteparolen - trotz verheerender Niederlagen und Hunderttausender ziviler Opfer durch alliierte Bombenangriffe. Die Botschaften preisen Opferbereitschaft und Ehrenkodex nach dem Vorbild der Samurai.
Anders als in Deutschland regt sich in Japan kaum öffentlicher Widerspruch. Das liegt am Kaiserkult: Kritik an der Armee käme einer Kritik am Tenno, dem obersten Befehlshaber, gleich. «Widerstandsgruppen wie in Deutschland gab es so auf breiter Basis nicht», sagt Sven Saaler, Professor für moderne japanische Geschichte an der Sophia-Universität Tokio.
Erste Risse im Durchhaltewillen
Noch im Winter 1944 muss General Tojo zurücktreten, weil er sein Versprechen gegenüber dem Kaiser, die Marianen-Inseln zu halten, nicht erfüllen kann. Nur eine öffentliche Kritik am Krieg ist bekannt, vom ehemaligen Premierminister Fumimaro Konoe. Er warnt im Februar 1945 vor der völligen Zerstörung Japans und drängt auf einen durch die Sowjetunion vermittelten Frieden.
Doch Kaiser Hirohito und sein Kabinett ignorieren das Memorandum, ebenso wie am 26. Juli die Potsdamer Erklärung der Alliierten mit der Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation. Erst die Abwürfe zweier Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sowie der sowjetische Kriegseintritt am 8. August 1945 ändern die Haltung des Kaisers.
Nach Einschätzung von Historiker Saaler sind nicht die Atombomben ausschlaggebend, sondern die Furcht vor einer sowjetischen Verwaltung Japans und der damit verbundenen Auflösung des Kaiserreichs. Am 14. August spricht Kaiser Hirohito in einem auf Tonband aufgenommenen Text zur Nation: «Der Kriegsverlauf hat sich nicht unbedingt zu Japans Vorteil entwickelt. Sollten wir den Kampf fortsetzen, wird die völlige Vernichtung unserer Nation die Folge sein. Wir müssen dulden und ertragen, was untragbar scheint.»
Dramatischer Coup-Versuch in letzter Minute
Noch am Abend des 14. August versuchen fanatische Offiziere das Unvorstellbare. Laut Welt führen Oberstleutnant Shiizaki Jiro und Major Hatanaka Kenji einen Putschversuch an, ermorden Divisionskommandeur Mori Takeshi und besetzen den Kaiserpalast. Die Putschisten dringen in die Rundfunkanstalt ein und versuchen verzweifelt, das Tonband mit der Kapitulationserklärung zu zerstören und das Kriegsende zu verhindern - ohne Erfolg.
Als die Kapitulation am 15. August 1945 landesweit verkündet wird, wählen acht hochrangige Militärs den Freitod. Armeeminister Anami Korechika bringt sich um, ebenso wie später der ehemalige Premierminister Konoe, der den Kaiser bereits im Februar zur Kapitulation gedrängt hatte.
Damit ist der Krieg mit mehr als zwei Millionen toten japanischen Soldaten und mehr als 730.000 toten Zivilisten beendet. Auch das Bild des Tennos, des Kaisers als oberster, gottgleicher Führer - dessen Stimme das Volk per Tonband erstmals überhaupt hört - ist gebrochen.
Symbol des Fanatismus: Soldat kämpft 29 Jahre weiter
Die Geschichte von Hiro Onoda zeigt, wie tief die militaristische Indoktrination reicht. Ende 1944 auf die philippinische Insel Lubang geschickt, kapituliert der Soldat erst am 9. März 1974 - fast drei Jahrzehnte nach Kriegsende. Gemeinsam mit zwei Kameraden führt Onoda einen Guerillakrieg, überfällt Dorfbewohner und tötet etwa 30 philippinische Zivilisten nach Kriegsende.
Flugblättern über die japanische Kapitulation glaubt er nicht. Erst als Japan seinen ehemaligen Offizier aufspürt und dieser ihm den offiziellen Befehl zur Kapitulation erteilt, ergibt sich Onoda. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos gewährt ihm Amnestie.
In Japan wird Onoda berühmt, seine Geschichte bleibt aber umstritten zwischen Pazifisten und Konservativen. Als Onoda 2014 stirbt, beschreibt ihn ein Sprecher des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe als «Symbol japanischer Ausdauer».
Schwierige Erinnerungskultur bis heute
Seit 1963 wird der 15. August als nationaler Gedenktag gefeiert. Bis heute liegt der Fokus jedoch hauptsächlich auf dem Gedenken an die japanischen Opfer. Obwohl sich mehrere Premierminister für den von Japan begonnenen Krieg entschuldigt haben, gibt es wenig öffentliche Erinnerungskultur.
Erst seit den 1990er Jahren werden Krieg und Kolonialherrschaft in Schulbüchern thematisiert. Einige Gräueltaten wie die Menschenversuche der «Unit 71» werden bis heute ausgelassen. Der verstorbene Premierminister Abe wurde für seinen Geschichtsrevisionismus kritisiert und ließ bestimmte Themen aus den Schulen verbannen.
Zwar erinnerte er 2015 vor dem US-Kongress an den Krieg, erntete aber scharfe Kritik für eine ausbleibende Entschuldigung an die überlebenden koreanischen Zwangsprostituierten. In diesem Jahr gibt es laut Medienberichten keine offizielle Erinnerungsrede zum 80. Jahrestag durch den japanischen Premier. Ob Amtsinhaber Shigeru Ishiba am 2. September an die offizielle Ratifizierung des Kriegsendes erinnert, ist noch unklar.
Verwendete Quellen: "ntv", "Welt" Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz überarbeitet.