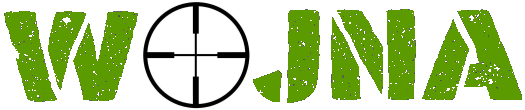Ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe kämpfen Tausende Menschen in der spanischen Region Valencia noch immer mit den Folgen der Naturkatastrophe. Sintflutartige Regenfälle hatten in der Nacht zum 30. Oktober 2024 binnen Stunden ganze Landstriche verwüstet.
Mehr als 220 Menschen starben bei der Katastrophe, Tausende wurden verletzt oder obdachlos. Die Schäden werden auf 17 bis 18 Milliarden Euro geschätzt - Straßen wurden fortgerissen, Fabrikhallen weggespült und Felder verwüstet.
Überleben im Notquartier
Zwölf Monate später zeigt sich das ganze Ausmaß der persönlichen Tragödien. Der 34-jährige Paco muss mit seiner Frau und den beiden Kindern weiterhin in einem zehn Quadratmeter großen Zimmer übernachten, weil sein Haus noch nicht vollständig repariert ist. «Ich habe Zukunftsangst und jede dritte, vierte Nacht Alpträume», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
Rund 20.000 Familien sind nach Angaben der Stiftung Fundación Madrina noch immer auf Lebensmittelausgaben angewiesen. «Viele mussten die staatlichen Hilfen vollständig in den Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser stecken», sagte Stiftungsleiter Conrado Giménez dem TV-Sender Antena 3.
Vor den Ausgabestellen bilden sich täglich lange Schlangen. José Ramón, dessen Erdgeschosswohnung komplett überflutet wurde, erzählte Antena 3: «Ich musste durchs Fenster fliehen, weil ich im Erdgeschoss wohnte.» Seine Wohnung baute er mit öffentlicher Hilfe und letzten Ersparnissen notdürftig wieder auf: «Ich habe alles verloren - Kleidung, Möbel, Geräte. Jetzt bekomme ich hier Lebensmittel und Putzmittel. Ohne das ginge es nicht.»
Das Dana-Phänomen als Auslöser
Auslöser der Katastrophe war eine «Dana» - ein meteorologisches Phänomen, das besonders im Herbst schwere Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen verursacht. Es entsteht, wenn eine isolierte, sehr kalte Luftmasse in der Höhe auf warme, feuchte Luft in Bodennähe trifft.
Experten verweisen auf den Klimawandel als verstärkenden Faktor. Das sich erwärmende Mittelmeer macht solche heftigen Unwetter wahrscheinlicher, da die bodennahe Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Mehr als 300.000 Menschen waren direkt von der Flut betroffen.
Politische Krise ohne Konsequenzen
Die Regionalregierung unter Präsident Carlos Mazón steht massiv in der Kritik. Warnungen über die Handys erfolgten zu spät, Evakuierungen wurden zu zögerlich organisiert. Obwohl bereits am Nachmittag des 29. Oktober erste Notrufe eingingen, wurde erst um 20.11 Uhr eine Warnung an alle Mobiltelefone verschickt - da standen viele Straßen bereits unter Wasser.
Zehntausende gingen seither immer wieder auf die Straße und forderten Mazóns Rücktritt. Viele Demonstranten tragen Hemden mit der Aufschrift «20:11 Ni oblit ni perdó» - valencianisch für «Kein Vergessen, kein Vergeben». Der konservative Politiker räumte zwar «Fehler» ein, blieb aber im Amt.
Milliardenhilfen und langsamer Fortschritt
Die Zentralregierung in Madrid kündigte ein Hilfsprogramm von 10,6 Milliarden Euro an, später kamen weitere 1,35 Milliarden hinzu. Die EU mobilisierte zusätzlich knapp 1,6 Milliarden Euro aus verschiedenen Fonds.
Dennoch kritisieren Betroffene, dass Hilfen zu langsam ankommen und sich ländliche Gemeinden abgehängt fühlen. Über 141.000 Fahrzeuge wurden zerstört, 800 Kilometer Straßen und 550 Kilometer Schienen beschädigt. Besonders die Landwirtschaft litt unter der Vernichtung zehntausender Hektar mit Zitrusfrüchten und Gemüse.
Ökologische Langzeitschäden
Neben den menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten sind die ökologischen Schäden gewaltig. Die Fluten spülten Industrieabwässer, Öle und Chemikalien in Flüsse und Feuchtgebiete. Böden wurden durch Schlamm und Erosion schwer beschädigt.
Klimaforscher erwarten, dass solche Extremwetterereignisse in Spanien künftig häufiger auftreten werden. Die entscheidende Frage bleibt, ob aus der Katastrophe Lehren für bessere Frühwarnsysteme und resilientere Infrastruktur gezogen werden.
(dpa) Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.