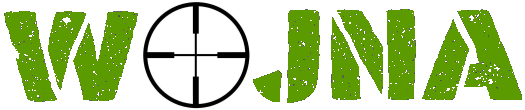Vor 80 Jahren erschien in Schweden ein Kinderbuch über ein neunjähriges Mädchen, das ohne Eltern lebt, nicht zur Schule geht und sich auch mal prügelt. «Pippi Langstrumpf» wurde sofort ein Riesenerfolg - und löste gleichzeitig heftige Kontroversen aus. Kritiker warnten vor einem «Zusammenbruch der öffentlichen Moral».
Das Buch war anders als alles, was es zuvor gab. Pippi durchbricht sämtliche Konventionen: Sie lebt mit einem Pferd und einem Affen in einem bunt gestrichenen Haus, trägt viel zu große Schuhe und hält nichts von «Plutimikation». Ihre Autorin Astrid Lindgren bat den Verlag augenzwinkernd, nicht das Jugendamt zu alarmieren.
«Die Hauptfigur durchbricht auf schockierende Weise gängige Normen; sie wird als eine Art kindlicher Superheld dargestellt, doch zugleich übt das Buch mit viel Humor Kritik an zeitgenössischen Vorstellungen von Kindheit, Identität und der Möglichkeit, sein Leben mitzugestalten», sagt die Literaturprofessorin Elina Druker von der Universität Stockholm zur Deutschen Presse-Agentur.
Genau diese Rebellion sorgte für Aufruhr. «Einige Lehrkräfte und Kritikerinnen sorgten sich über Pippis rebellische Art und die fehlende Aufsicht; manche warnten sogar vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Moral», erklärt Druker. Trotz aller Bedenken setzte sich das Buch durch.
Der Erfolg war global: 1949 erschien die erste deutsche Ausgabe, mittlerweile sind die Bücher in 80 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt worden. «Pippi Langstrumpf» legte den Grundstein für Lindgrens Karriere, es folgten «Michel aus Lönneberga», «Wir Kinder aus Bullerbü» und «Ronja Räubertochter».
Von der Gutenachtgeschichte zum Weltbestseller
Die Geschichte begann 1941 als Gutenachtgeschichte. Lindgrens siebenjährige Tochter Karin lag mit einer Lungenentzündung im Bett und bat ihre Mutter: «Erzähl von Pippi Langstrumpf.» Das Mädchen erfand in diesem Moment den Namen der Figur, die Generationen von Kindern prägen sollte.
Drei Jahre später verstauchte sich Lindgren auf einem eisglatten Stockholmer Gehweg den Knöchel. Während sie das Bett hüten musste, schrieb sie die Pippi-Geschichten auf - als Geburtstagsgeschenk für Karin. 1945 schickte sie das Manuskript an einen kleinen Stockholmer Verlag und gewann damit den ersten Platz bei einem Preisausschreiben. Kurz nach Kriegsende erschien das Buch.
Die Kriegszeit hinterließ Spuren im Text. Der gemeine Zirkusdirektor spricht in der schwedischen Ausgabe mit deutschem Akzent. Pippi besiegt im Zirkus den «stärksten Mann der Welt» namens «starker Adolf» - allerdings nicht aus Kampfeslust. «Aber ich finde es schade, ihn zu verhauen, er sieht so nett aus», sagt sie zu ihren Freunden Tommy und Annika.
Stärke trifft auf Empathie
Lindgren schrieb konsequent aus der Perspektive von Kindern. «Ich bin sehr kindlich. In mir lebt wahrscheinlich ein kleines Kind. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es war, ein Kind zu sein, wie ein Kind fühlt und reagiert», sagte die Autorin einmal.
Neben absurdem Humor schwingt auch Melancholie mit. Pippi singt sich selbst in den Schlaf, weil keine Eltern da sind. Sie ruft regelmäßig zu ihrer verstorbenen Mutter in den Himmel: «Hab keine Angst! Ich komme immer zurecht!» Lindgren, die als 18-Jährige außerehelich schwanger wurde und ihren Sohn zunächst bei Pflegeeltern aufwachsen sehen musste, verarbeitete wohl auch eigene Erfahrungen.
Die zentrale Botschaft macht das Buch bis heute relevant. «Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt, aber sie ist auch rebellisch, gütig und großzügig», sagt Druker. Pippi missbraucht ihre Stärke nicht - sie setzt sie ein, um Schwächeren zu helfen. «Obwohl ihre Kinderbücher nie offen politisch sind, spielen Widerstand sowie die Themen Freundlichkeit, Macht und Kinderrechte eine wichtige Rolle», erklärt die Literaturprofessorin.
Genau diese Verbindung von Stärke und Empathie macht «Pippi Langstrumpf» auch 80 Jahre nach der Erstveröffentlichung zu einem Buch, das in heutigen Zeiten äußerst relevant bleibt.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.